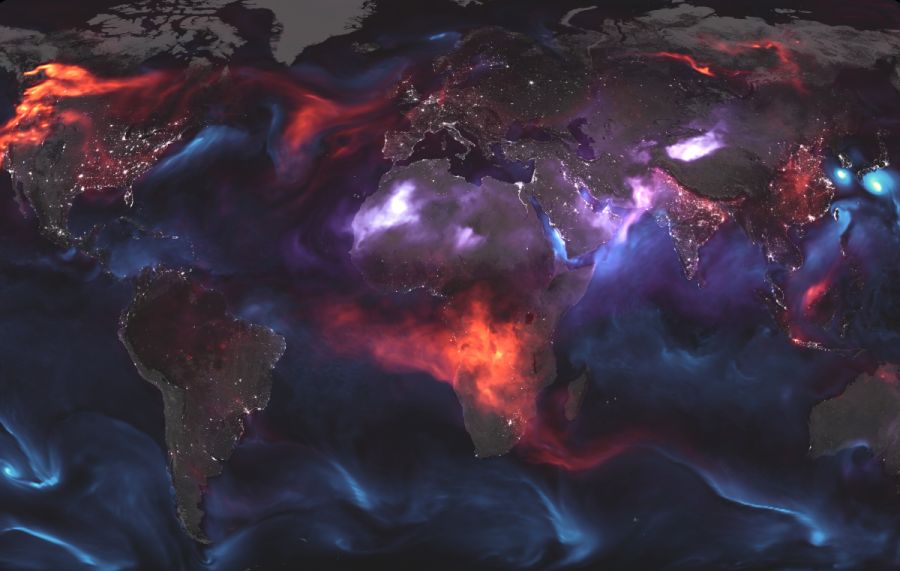Das Ende des Jahres ist eine hektische Zeit, nicht nur im Einzelhandel, sondern auch in den Finanzhäusern und Finanzredaktionen. Es ist die Zeit der Prophetie. Wo steht der Deutsche Aktienindex (Dax) am Ende des kommenden Jahres? Was ist mit dem Euro? Oder dem Goldpreis? Oder den vielen anderen Indizes, Währungen und Rohstoffen? Die Analysten und Strategen der Finanzinstitute sind gefragt – qua Amt dazu berufen, möglichst präzise Vorhersagen zu treffen, wohin die Kurse in den kommenden zwölf Monaten drängen.
In den Finanzressorts der Zeitungen werden die Seiten freigeräumt für große Tabellen mit vielen Prognosen der unterschiedlichsten Prognosegeber, fein säuberlich eingetragen, Spalte neben Spalte, jeweils mit den unterschiedlichen Vorhersagen zu unterschiedlichen Anlagen versehen: So wird 2020! Die große Vorschau. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Wenn gerade nichts Spektakuläres passiert, taugt die Vorschau gar zum Zeitungs- oder Magazinaufmacher. Verkauft sich gut am Kiosk. Die Tabelle ist meist so platziert, dass sie sich gut ausschneiden lässt. Was viele Leser auch gerne tun – und sie dann an die Pinnwand heften. Ein bisschen so, wie sie es mit der Stecktabelle des Kicker-Sonderhefts vor Beginn einer jeden Fußballbundesliga-Saison tun.
Das Problem an der Geschichte ist, dass die Kicker-Stecktabelle mehr Aussagekraft hat als die Dax-Dow-Euro-Gold-Heiz-und-Palmöl-Tabelle. Die Kandidaten für den kommenden deutschen Meister, das haben die vergangenen Jahre gelehrt, lassen sich recht verlässlich eingrenzen. Bei den Absteigern wird es dagegen etwas schwieriger. Da ist immer mal wieder einer dabei, den man dort nicht unbedingt vermutet hätte, einerseits.

Dax, Dow & Co: Eine Jahresprognose ist schlicht unmöglich
Andererseits ist das Vertrauen in die Dax-Prognosen der Finanzbranche weit größer als in die Stecktabelle, weil diejenigen, die die Prognose machen – das ist zumindest die Perspektive des geneigten Lesers –, sich ja den ganzen Tag über mit nichts anderem beschäftigen als mit den Faktoren, die letztlich die Prognose bedingen. Das tun sie, sicherlich, trotzdem können sie es nicht wissen. Denn zahllose Faktoren wirken auf die verschiedenen Märkte ein, auch Unwägbarkeiten und Katastrophen. Eine Prognose über einen so kurzen Zeitraum, und nichts anderes sind zwölf Monate, ist schlicht unmöglich.
Das wissen im Übrigen auch die Prognosegeber. Sie versuchen sich trotzdem daran, weil sie dafür bezahlt werden und der, der zahlt, nicht ungern in der Zeitung steht. Nicht zuletzt gehen die Vorhersager davon aus, dass das Publikum genau das von ihnen erwartet – Prognosen. Licht ins Dunkel der Unwägbarkeiten bringen, sei es auch noch so schwach. Das hilft, Ängste zu überwinden. Der Mensch sehnt sich nach Gewissheiten, auch wenn es die in Wahrheit gar nicht gibt. Das ist nachvollziehbar, kurz: menschlich.
Die Medien wissen ebenfalls um den begrenzten Wert der Prognosen. Aber eben auch um das Bedürfnis der Leser und damit die Attraktivität der Geschichte, die zudem verbunden ist mit der Aussicht auf eine Folgegeschichte. Denn wer Prognosen abfragt, der kann diese – mit etwas Abstand – auch bewerten. Also denjenigen beglückwünschen, der (zufälligerweise) besonders gut lag mit seiner Einschätzung, und diejenigen vors Schienbein treten, die – rückblickend – völlig abstruse Prognosen abgegeben hatten.
Lieber Crash-Prophet als Gesundbeter
Der Prognosegeber hat letztlich zwei Möglichkeiten der Prognose-Herleitung, hier exemplarisch an der allseits beliebten Indexprognose „Wo steht der Dax am Ende des Jahres 2020“ ausgeführt. Möglichkeit eins ist die defensive Variante. Der Analyst nimmt dazu die historische Wertentwicklung, also die durchschnittliche jährliche Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, und schlägt sie auf den aktuellen Kurs drauf – oder zieht sie ab, je nach gefühlter Marktlage. Damit taugt er nicht zum Helden der Geschichte, weil es ihm viele gleichtun, er deshalb nicht auffällt. Genau das ist das Kalkül: Nicht auffallen, nicht Gefahr laufen, später vors Scheinbein zu bekommen – aber dabei sein.
Den Tritt wiederum nimmt der Befürworter von Möglichkeit zwei, der offensiven Variante, billigend in Kauf. Ihm geht es darum, möglichst große Aufmerksamkeit mit seiner Prognose zu erzielen, also im besten Falle der Held der Geschichte zu werden. Dass tut er, indem er möglichst weit vom Prognosemittelwert abweicht; wenngleich auch er ein „Sicherheitsnetz“ einzieht. Denn er wird mit großer Wahrscheinlichkeit nach unten abweichen, also den Rückschlag vorhersagen, womöglich sogar den Crash. Denn der Untergangsprophet ist weit besser beleumundet, als derjenige, der neue Höchststände ausruft. Ein kritischer Geist, als der er höchstwahrscheinlich auch dann gilt, wenn seine Prognose nicht eintrifft. Dann eben ein Jahr später. Weit schlechter steht der Optimist da, sollte er falschliegen. Als Gesundbeter und Traumtänzer. Unverbesserlich. Seit der Dotcom-Krise sollte man sich allzu optimistische Prognosen besser verkneifen.

Prognosen sind fester Bestandteil der Börsenfolklore
Im Grunde genommen bilden Prognosegeber und Medien eine Interessengemeinschaft. Eine Verbindung, für die es durchaus nachvollziehbare Gründe gibt, und die über Jahre gewachsen, also immer inniger geworden ist – und deshalb kaum mehr hinterfragt wird. Ein fester Bestandteil der Börsenfolklore, so wie die Börsenglocke an der New Yorker Wall Street. Der kleine, aber entscheidende Unterschied: Die Börsenglocke schadet niemandem, der Prognosezirkus dagegen schon. Nämlich all denen, die sich daran orientieren, weil sie es schlicht nicht besser wissen, den wahren Wert der Jahresprognosen nicht einschätzen können. Wer liest, der Crash stünde in den kommenden zwölf Monaten bevor, und daraufhin sein Depot umkrempelt, könnte schon bald als großer Verlierer dastehen.
Wer dagegen weiß, wie diese Punktprognosen entstehen, kann sie als das ansehen, was sie im besten Falle sind: Unterhaltung. Nicht mehr. Er wird erkennen, dass am Ende eines Börsentages, der vollgepackt ist mit marktschreierisch vorgetragenen News, gar nicht so viel Relevantes übrig bleibt. Der Lärm, der tagein, tagaus gemacht wird, ist schnell verklungen.
*Elmar Peters ist Fondsmanager bei der Flossbach von Storch AG. Er leitet gemeinsam mit Bert Flossbach das Multi-Asset-Team. Der Beitrag erschein zuerst in „Position“, dem Kundenmagazin des Vermögensverwalters.